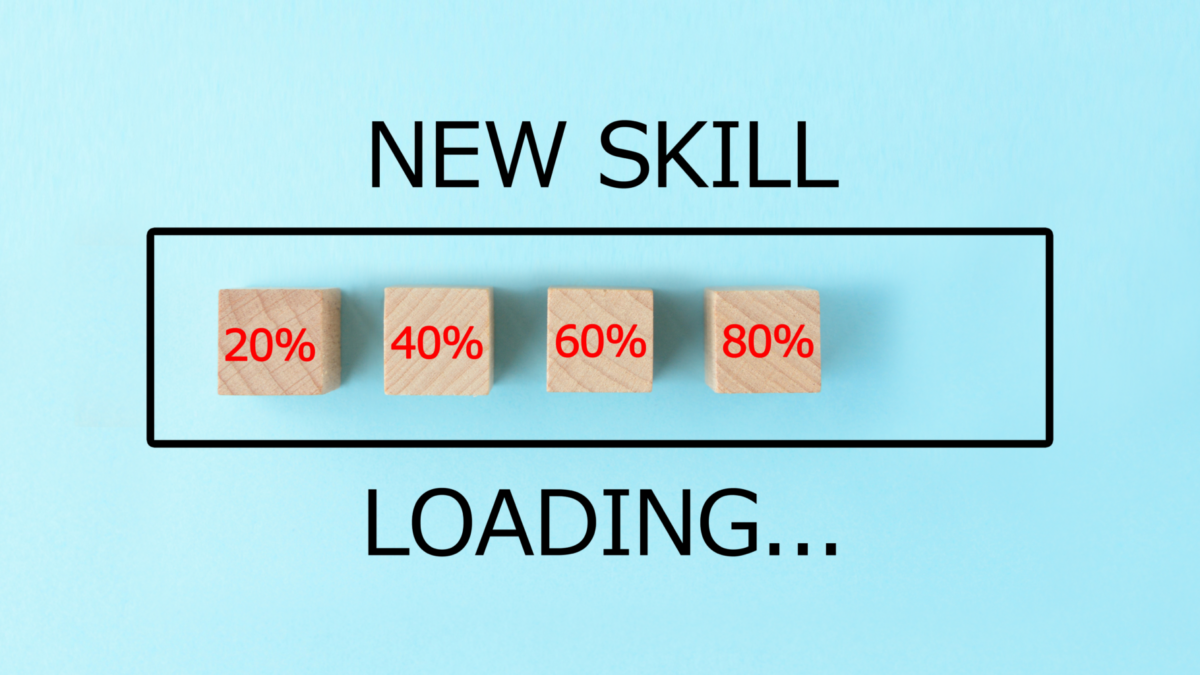Die Europäische Kommission hat endlich wieder eine Gleichstellungsstrategie veröffentlicht: kurz vor dem Internationalen Frauentag erschien am 5. März 2020 die Mitteilung mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020 – 2025. Die letzte Strategie war 2015 ausgelaufen und lediglich durch ein Arbeitsdokument mit dem Titel „Strategisches Engagement der Kommission für die Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019“ ersetzt worden.
Auf Initiative Bremens hatte sich die Gleichstellungs- und Frauenminister*innenkonferenz (GFMK) seit 2015 mehrfach für eine neue eigenständige EU-Gleichstellungsstrategie ausgesprochen. Die Kommission kündigt für die kommenden fünf Jahre viele Initiativen an, um die Gleichstellung von Frauen und Männern in der EU zu fördern. Was die EU in Gleichstellungsfragen schon erreicht hat, was sie darf und was sie in Zukunft vorhat, soll hier kurz erklärt werden.
Lohngleichheit, Antidiskriminierung, Mutterschutz – eine kurze Geschichte der europäischen Gleichstellungspolitik
Schon bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1957 wurde in den Römischen Verträgen festgehalten, dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn erhalten sollen. Seitdem konnten die EU und ihre Vorgängerorganisationen Rechtsvorschriften erlassen, um europaweite Mindeststandards zu schaffen. So trat 1975 die EWG-Richtlinie zur Entgeltgleichheit in Kraft. 1992 weitete der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft (EG) die europäischen Kompetenzen auf Themen wie Chancengleichheit und Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt aus. Im selben Jahr erlangte die Mutterschutzrichtlinie Gesetzeskraft. Seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im Jahr 1999 kann die Europäische Gemeinschaft darüber hinaus Rechtsvorschriften erlassen, um Diskriminierung – unter anderem aufgrund des Geschlechts – zu bekämpfen. Im Jahr 2010 legte die EU in einer Richtlinie Mindeststandards für Elternzeit fest. Damit setzte sie eine Einigung um, die von Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen auf europäischer Ebene ausgehandelt worden waren. 2019 einigten sich die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament schließlich auf eine weitergehende Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer in der EU hat seitdem mindestens Anspruch auf vier Monate bezahlter Elternzeit, wobei die Mitgliedstaaten die Höhe dieser Bezahlung selbst festlegen.
Auch die Tatsache, dass Versicherungen die Prämien für Frauen und Männer nicht unterschiedlich berechnen dürfen, ist der EU zu verdanken. Zwar hatte die EU-Gleichbehandlungsrichtlinie von 2004 diese Form der Diskriminierung ausdrücklich erlaubt, der entsprechende Artikel wurde aber im Jahr 2011 vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt.
Die Gleichstellungsstrategie 2020-2025
Die nun vorgelegte Strategie bildet den Rahmen für die Arbeit der Europäischen Kommission auf dem Gebiet der Gleichstellung der Geschlechter und gibt die politischen Ziele und die wichtigsten Maßnahmen für den Zeitraum 2020-2025 vor. Sie ist einem dualen Ansatz aus konkreten Maßnahmen und Gender Mainstreaming verpflichtet, also der Einbeziehung der Geschlechterdimension als Querschnittsthema in alle Politikbereiche und Maßnahmen. Die Strategie bezieht sich insbesondere auf die Aktionsplattform von Peking aus dem Jahr 1995 und das Ziel Nr. 5 (Gleichstellung der Geschlechter) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung aus dem Jahr 2015. Dabei beschränkt sich die Kommission keineswegs auf die Arbeitswelt, sondern nutzt auch den Umstand, dass sie in anderen Politikbereichen eine beratende und koordinierende Funktion für die Mitgliedstaaten einnehmen kann. Sie geht in der Gleichstellungsstrategie von einem binären Geschlechtermodell aus. Ein Absatz widmet sich zwar dem Bereich der Mehrfachdiskriminierung, der auch LGBTI*-Personen ausgesetzt sind, dennoch herrscht ein Geschlechterverständnis vor, das sich auf Frauen und Männer beschränkt. Die Kommission hat allerdings angekündigt, Ende 2020 eine eigene Strategie zur Inklusion von LGBTI* vorzulegen.
Die Gleichstellungsstrategie definiert für die Gleichstellung der Geschlechter sechs Ziele, teils noch in Unterziele gegliedert, und verknüpft diese jeweils mit konkreten Maßnahmen, die im Folgenden dargestellt werden:
Geschlechtsspezifische Gewalt beenden:
- Ratifizierung der Istanbul-Konvention des Europarates, die von der EU bereits 2017 unterzeichnet wurde. Sollte die Ratifizierung weiterhin im Rat blockiert werden, will die Europäische Kommission im Jahr 2021 Maßnahmen im Rahmen der Zuständigkeit der EU vorschlagen, mit denen die Ziele des Übereinkommens erreicht werden sollen.
- Ausweitung der „EU-Straftatbestände“, bei denen eine Harmonisierung nach Art. 83 AEUV möglich ist, auf geschlechtsspezifische Gewalt.
- Empfehlungen an die Mitgliedstaaten zur Verhinderung schädlicher Praktiken wie weiblicher Genitalverstümmelung, Zwangsabtreibung und Zwangssterilisierung, Früh-und Zwangsehe oder „Gewalt im Namen der Ehre“.
- Vorlage einer Strategie für Opferrechte auf Grundlage der Opferschutzrichtlinie mit besonderem Fokus auf die Opfer geschlechtsbezogener Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt.
- Erarbeitung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Problemen.
- Einrichtung eines EU-Netzes zur Verhütung von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt, um Mitgliedstaaten und Interessenträgern den Austausch bewährter Verfahren zu ermöglichen.
- Finanzierung von Schulungen, Kapazitätsaufbau und Unterstützungsdiensten. Von Besonderer Bedeutung soll dabei Gewaltprävention sein, die sich an Jungen und Männer
- Ratifizierung des ILO-Übereinkommens über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt.
- Der von der Europäischen Kommission geplante Rechtsakt über digitale Dienstleistungen soll klarstellen, welche Maßnahmen Plattformen ergreifen müssen, um gegen illegale Aktivitäten vorzugehen. Davon verspricht sich die Kommission auch eine Eindämmung von Online-Gewalt gegen Frauen wie Mobbing und Belästigung.
- Vorlage einer neuen EU-Strategie zur Beseitigung des Menschenhandels sowie eine EU-Strategie zur wirksameren Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs an Kindern.
- EU-weite Erhebung von Daten zu Gewalt gegen Frauen durch Eurostat.
- Im Rahmen des Forschungsprogramms Horizont Europa (2021-2027) sollen Lösungen aufgezeigt werden, um geschlechtsspezifische Diskriminierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu bekämpfen.
- Vorlage einer Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter in der audiovisuellen Industrie
- Förderung der Geschlechtergleichstellung durch das Programm Kreatives Europa.
Verringerung der geschlechtsbedingten Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt:
- Die Europäische Kommission will sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
- Integration der Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Agenda 2030) (und damit auch Ziel 5) in das Europäische Semester.
- Leitlinien für die Mitgliedstaaten, um zu erläutern, wie durch nationale Steuer-und Sozialleistungssysteme finanzielle Anreize oder Negativanreize für Zweitverdienende entstehen können.
- Entwicklung von gezielten Maßnahmen zur Frauenförderung in Horizont Europa, einschließlich eines Pilotprojekts zur Förderung von Start-ups und KMU, die von Frauen geführt werden.
Verwirklichung einer ausgewogenen Beteiligung von Frauen und Männern in verschiedenen Wirtschaftszweigen:
- Die aktualisierte europäische Agenda für Kompetenzen soll sich mit der horizontalen Segregation, Stereotypisierung und geschlechtsbedingten Unterschieden in der allgemeinen und beruflichen Bildung
- Der Aktionsplan für digitale Bildung soll der Unterrepräsentanz von Frauen in MINT-Studiengängen (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaft und Technik) entgegenwirken.
- Schlüsselstellung der Gleichstellungsdimension in der angekündigten Mitteilung der Europäischen Kommission über den europäischen Bildungsraum.
- Erneuerung des strategischen Rahmens für die Gleichstellung der Geschlechter im Sport, auch um die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in Führungspositionen in Sportorganisationen zu fördern.
Bekämpfung des Lohn- und Rentengefälles zwischen Frauen und Männern:
- Vorlage verbindlicher Maßnahmen zur Entgelttransparenz noch in diesem Jahr. Dazu wurde mit der Veröffentlichung der Gleichstellungsstrategie auch ein Konsultationsverfahren mit der Öffentlichkeit, den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern eingeleitet.
- Prüfung der Anrechnung von pflegebedingten Unterbrechungen in der betrieblichen Altersversorgung.
Abbau des Gefälles bei Betreuungs- und Pflegeaufgaben:
- Vorschlag für eine Überarbeitung der Barcelona-Ziele für den Ausbau von Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder.
- Unterstützung für Initiativen der Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit hochwertiger Kinderbetreuung durch Investitionen aus ESF Plus, EFRE, InvestEU und ELER.
- Grünbuch über das Altern Ende 2020, mit den Schwerpunkten Langzeitpflege, Renten und aktives Altern.
Verwirklichung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen und Politik:
- Die Europäische Kommission wird auf die Annahme des seit 2012 vorliegenden Vorschlags für eine Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen drängen. Dieser sieht vor, dass unter den nicht geschäftsführenden Mitgliedern in den Leitungsorganen von Unternehmen mindestens 40% dem unterrepräsentierten Geschlecht angehören müssen.
- Verpflichtung für europäische Parteien, die EU-Mittel beantragen, Transparenz bezüglich der ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern unter ihren Parteimitgliedern
- Innerhalb der Europäischen Kommission soll bis 2024 auf allen Führungsebenen Geschlechterparität hergestellt werden und der Anteil weiblicher Führungskräfte in den Agenturen der Kommission erhöht werden.
- In alle wichtigen Initiativen der Europäischen Kommission während der laufenden Amtszeit (2019-2024) soll die Geschlechterperspektive einbezogen Dies soll durch die Gleichstellungskommissarin sowie durch eine aus allen Kommissionsdienststellen und dem Europäischen Auswärtigen Dienst besetzte Task-Force für Gleichheitspolitik sichergestellt werden.
- Überschneidungen zwischen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts und aus anderen Gründen sollen ebenfalls in allen Politikbereichen der EU behandelt werden. Der Aktionsplan für Integration und Inklusion sowie die strategischen Rahmen der EU für Menschen mit Behinderungen, LGBTI+, die Integration der Roma und die Rechte des Kindes sollen mit der Gleichstellungsstrategie und untereinander verknüpft werden.
- Berücksichtigung der Gleichstellung in den Finanz- und Haushaltsinstrumenten, insbesondere ESF+, EFRE, Kreatives Europa, EMFF, Kohäsionsfonds und InvestEU.
- Der Kommissionsvorschlag für die Dachverordnung für die Umsetzung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds enthält unter anderem die Grundvoraussetzung, dass Mitgliedstaaten, die die Fonds in Anspruch nehmen wollen, über einen nationalen strategischen Rahmen für die Gleichstellung der Geschlechter verfügen müssen und auch die EU-Grundrechtecharta umsetzen müssen.
- Bereitstellung von Mitteln zur Verhütung und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt im Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“.
- Strategie für Inklusion und Vielfalt für das künftige Erasmus-Programm.
- Förderung der Gleichstellung der Geschlechter bei öffentlichen Ausschreibungen durch die Leitlinien der Kommission zur sozial verantwortlichen Vergabe öffentlicher Aufträge.
- Verbesserung des Gender Mainstreaming im Haushaltsverfahren auf Basis einer derzeit laufenden Prüfung durch den Europäischen Rechnungshof.
- Erneuerung des Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frau in den Außenbeziehungen.
- Kampagne #withher im Rahmen der Spotlight-Initiative in Zusammenarbeit mit der Vereinten Nationen.
- Vorlage eines EU-Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie 2020-2024 sowie weitere Umsetzung des Strategischen Konzepts und des Aktionsplans der EU für Frauen, Frieden und Sicherheit 2019-2024.
- Aktive Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in der Handelspolitik.
- Nutzung der Investitionsoffensive für Drittländer, um die unternehmerische Tätigkeit von Frauen und ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt zu fördern.
- Einbeziehung der Geschlechterdimension in der EU-Strategie für Afrika.
- Gender Mainstreaming im Haushaltsverfahren mit dem Ziel, dass 85% aller neuen auswärtigen Programme zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle der Frau beitragen.
Kontakt
Wolf Krämer
Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa
Landesvertretung Brüssel
T +32 2 282 00 77
wolf.kraemer@europa.bremen.de