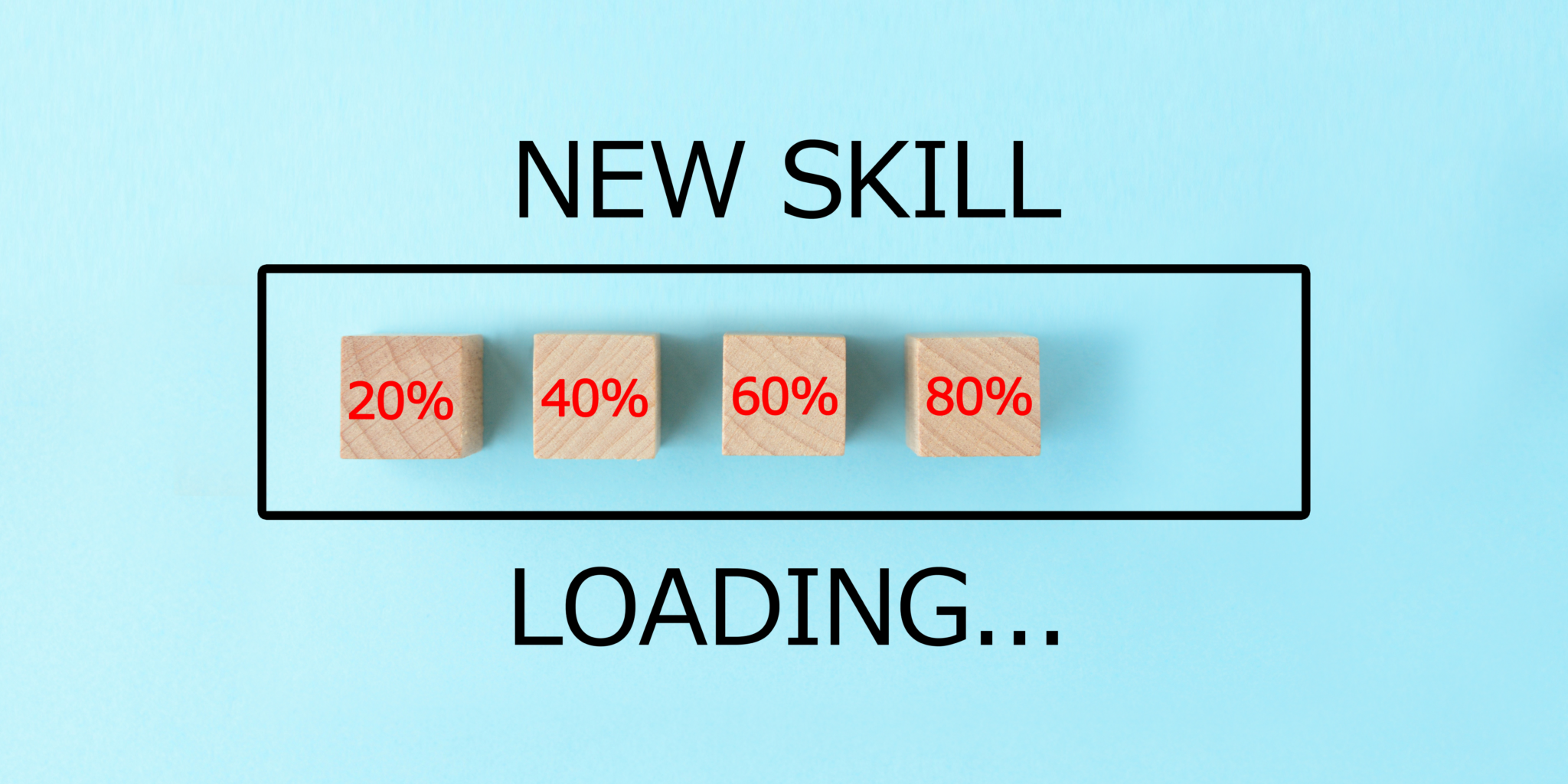Wolf Krämer / Caroline Zambiasi, Europaabteilung
Einleitung
Die Opfer von Straftaten müssen jederzeit Zugang zu Unterstützung und Schutz haben. Dieser Meinung ist auch die Europäische Kommission, die am 24. Juni 2020 erstmals eine „EU-Strategie für die Rechte von Opfern (2020 – 2025)“ vorlegte. Insbesondere der besorgniserregende Anstieg der häuslichen Gewalttaten während der COVID-19-Pandemie zeigt, dass es an der Zeit ist, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte der Opfer von Straftaten auch in Krisensituationen zu gewährleisten.
Für die kommenden fünf Jahre kündigt die Kommission deshalb viele Maßnahmen an, die sie selbst ergreifen möchte. Zudem empfiehlt sie den Mitgliedstaaten und Interessensgruppen tätig zu werden, um eine bessere Anwendung der EU-Vorschriften für Opferrechte in der Praxis sicherzustellen. Was die EU in Opferrechtsfragen schon erreicht hat und in Zukunft noch vorhat, soll hier kurz erklärt werden.
Zugang zu Informationen, Unterstützung und Schutz, sowie psychosoziale Prozessbegleitung – die Geschichte der Opferrechte in der EU
Bereits 2012 hat die Europäische Union Vorgaben zur Unterstützung der Opfer von Straftaten beschlossen. Die Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten (Opferschutzrichtlinie) umfasst das Recht auf Zugang zu Informationen, das Recht auf Unterstützung und Schutz in Abhängigkeit der individuellen Bedürfnisse der Opfer, sowie eine Reihe von Verfahrensrechten. Insbesondere die psychosoziale Prozessbegleitung der Opfer von Straftaten erhielt mit der Opferschutzrichtlinie einen wichtigen Stellenwert. Künftig sollen besonders schutzbedürftige Opfer die Möglichkeit haben, vor, während und nach der Hauptverhandlung professionell begleitet zu werden. Nicht zuletzt Kinder und Jugendliche, die Opfer schwerer Sexual- oder Gewaltdelikte wurden, erhielten fortan einen Rechtsanspruch auf kostenlose psychosoziale Prozessbegleitung. Für grenzüberschreitende Straftaten hingegen soll die Richtlinie über die Europäische Schutzanordnung sicherstellen, dass eine in einem Mitgliedstaat angeordnete Schutzmaßnahme für ein Opfer auch in einem anderen Mitgliedstaat gilt, sodass der gewährte Schutz an jedem Ort innerhalb der EU aufrechterhalten und fortgesetzt werden kann. Darüber hinaus hat sich die Europäische Union vertiefend mit den besonderen Bedürfnissen der schutzbedürftigen Opfer einzelner Straftaten befasst und entsprechende Regelungen eingeführt, welche wichtige Akzente setzen, um europaweite Mindeststandards zu schaffen. Dazu zählen unter anderem die Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandelns, die Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern, die Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung und die Richtlinie zur Entschädigung der Opfer von Straftaten. Zusätzlich bietet das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – auch Übereinkommen von Istanbul oder Istanbul-Konvention genannt – einen völkerrechtlichen Rahmen, dessen verbindliche Rechtsnormen als erweiterte Grundlage der EU-Rechtsvorschriften zum Opferschutz dienen sollen. Dieses Übereinkommen wurde bereits von der Europäischen Union unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Damit es gelingt, auf europäischer Ebene einheitliche Schutzstandards zu schaffen, ist es wichtig, dass möglichst alle 46 Mitgliedstaaten des Europarates dem Übereinkommen beitreten. Mit Deutschland haben insgesamt 21 EU-Mitgliedstaaten die Istanbul-Konvention unterschrieben und ratifiziert. Bislang fehlen noch Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Litauen, Lettland sowie die Slowakei. Zudem plant Polen den Austritt.
Die EU-Strategie für die Rechte von Opfern 2020 – 2025
Die nun vorgelegte Strategie für die Rechte von Opfern bildet den Rahmen für die Arbeit der Europäischen Kommission auf dem Gebiet des Opferschutzes. Sie beruht auf einem zweigliedrigen Ansatz: die Stärkung der Opfer von Straftaten und die gemeinsame Förderung der Rechte der Opfer. Die rechtlich unverbindliche Strategie erläutert hierfür zum einen die nächsten Schritte, die die Kommission unternehmen will. Sie ruft allerdings zum anderen auch die Mitgliedstaaten, Interessengruppen und allgemein die Zivilgesellschaft zum Tätigwerden auf. Dabei widmet sie den spezifischen Bedürfnissen der Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt besondere Aufmerksamkeit und legt die politischen Ziele und die wichtigsten Maßnahmen für den Zeitraum 2020-2025 fest. Der Fokus der Strategie liegt insbesondere auf der besseren Umsetzung und Anwendung der gesetzlich verankerten Opferrechte (insbesondere der Opferschutzrichtlinie). Opfern von Straftaten soll dabei eine hohe Qualität an Schutz und Zugang zu Informationen zu ihren Rechten geboten werden. Sie sollen dazu ermutigt werden, Straftaten anzuzeigen und an den Strafverfahren teilzunehmen, um Entschädigung zu erwirken und sich schlussendlich von den Folgen der Straftaten erholen zu können. Es gilt vor allem, geeignete Strukturen zu etablieren, die den Schutz in Abhängigkeit der individuellen Bedürfnisse sicherstellen. Des Weiteren müssen alle Kontaktstellen der Opfer geschult werden und die Rechte der Opfer im vollen Umfang im Bewusstsein haben.
Welche Maßnahmen hält die Kommission im Einzelnen für sinnvoll und welche Opfergruppen stehen besonders im Fokus der EU-Strategie für die Rechte von Opfern (2020 – 2025)?
EU Opferschutz
- Die Stärkung der Opfer von Straftaten setzt voraus, dass diese überhaupt ihre Rechte und Ansprüche kennen. Kontaktpersonen und Fachleute, die mit den Opfern von Straftaten in Kontakt treten, sollen diese daher zwingend über ihre Rechte und ihren Zugang zu einer Entschädigung informieren. Ferner sollen sie geschult und entsprechend sensibilisiert werden, um Straftaten zu erkennen und in angemessener Weise damit umgehen können, um den Opfern die Angst vor dem Täter oder den möglichen negativen Folgen einer Anzeige und der Teilnahme am Strafverfahren zu nehmen.
- Die Kommission wird eine EU-Sensibilisierungskampagne für die Rechte der Opfer einleiten und fachliche Schulungsmaßnahmen fördern, um allen Opfern von Straftaten – unabhängig von ihrem Hintergrund - die Möglichkeit zum Zugang zu Justiz und Unterstützung zu garantieren.
- Durch allgemeine Informationskampagnen über Opferrechte und interaktive Websites sollen Opfer von Straftaten besser über die nationalen Entschädigungsregelungen informiert werden.
- Strafverfolgungsbehörden sollen mit Unterstützung der Kommission und der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) eine bessere Kommunikation sowie ein besseres Verständnis der Rechte und Opfer
- Die hohe Qualität des Schutzes und die Zuverlässigkeit der Informationen über die Rechte der Opfer soll in Zusammenarbeit mit der Kommission, den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Justizportal weiter verbessert werden. Die Datenbank wird sodann einem breiten Spektrum an Endnutzer*innen zur Verfügung stehen, dazu gehören Opfer, Opferschutzorganisationen und nationale Behörden.
- Die Opferrechte sollen unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Opfer in nichtdiskriminierender Weise gelten, dies gilt auch für unbegleitete Minderjährige.
- Intensive Zusammenarbeit der nationalen Behörden mit den entsprechenden Organisationen sowie ethnischen, religiösen und anderen Minderheitsgemeinschaften soll eine zielgerichtete und integrierte Unterstützung für schutzbedürftige Opfer bieten.
- Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, ihre einzelstaatlichen Entschädigungsregelungen opferfreundlicher zu gestalten, indem sie die Vorschriften über den Zugang zur Entschädigung vereinfachen und die verfügbaren Entschädigungssummen durch Anpassung der nationalen Haushalte erhöhen, um eine gerechte und angemessene Entschädigung der Opfer zu ermöglichen.
- Außerdem will die Kommission die Umsetzung der bestehenden EU-Rechtsvorschriften, namentlich der Entschädigungsrichtlinie und des Rahmenbeschlusses über die gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen, strenger überwachen.
- Die Kommission will außerdem eine Verbesserung der Koordinierung und Zusammenarbeit innerhalb der EU und soweit wie möglich auch global erreichen, um für Opfer von Straftaten den Zugang zur Justiz zu gewährleisten.
- Sie will hierfür eine Plattform für Opferrechte etablieren, über die sich alle Beteiligten vernetzen, die sich auf EU-Ebene mit Opferrechten befassen.
- Zusätzlich hierzu soll ein neu zu benennender Koordinator für Opferrechte die Kohärenz und Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Politik im Bereich der Opferrechte und das reibungslose Funktionieren der Plattform für Opferrechte
- Außerdem soll die Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Partnern wie den Vereinigten Nationen und dem Europarat gestärkt werden, um hohe internationale Standards für Opferrechte zu fördern.
- Mit dem Einsatz von EU-Finanzmitteln und der Fortführung des politischen Dialogs sollen Opferrechte international gefördert und geschützt werden, um den Opfern in den Partnerländern den Zugang zur Justiz zu gewährleisten.
- Um die Opfer von Straftaten und ihre Familienangehörigen vor weiterer Gewalt zu schützen, prüft die Kommission die Einführung von Mindeststandards für den physischen Schutz der Opfer im nationalen Recht, einschließlich der Mindestanforderungen für die Erteilung und die Ausgestaltung von Schutzmaßnahmen in Zeiten der COVID-19-Pandemie.
- Für den Schutz kindlicher Opfer ist es von entscheidender Bedeutung, spezielle Meldemechanismen von Straftaten zu gewährleisten und in den Verfahren mit größter Sorgfalt vorzugehen, um zu vermeiden, dass sie sekundäre Viktimisierung erfahren.
- Weil Kindern meist die erforderlichen digitalen Kompetenzen fehlen und sie mangelnde Kenntnis über die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel haben, soll ihnen die notwendige Hilfe bei der Erstattung von Anzeigen im Bereich der Cyberkriminalität gewährleistet werden.
- Speziell auf Kinder bezogene EU-Vorschriften sollen im Rahmen der Opferschutzrichtlinie umgesetzt werden. Zudem will die Kommission die Überwachung der nationalen Rechtssysteme in Bezug auf ihre Kinderfreundlichkeit verstärken. Dies soll u.a. durch die für 2021 geplante, und zieht dafür die umfassende Strategie für das Kindesrecht geschehen, die gezielten Maßnahmen für Kinder enthalten wird. Einen wichtigen Stellenwert kommt dabei der institutionellen Förderung von Kinderhäusern zu.
- Die Kommission beabsichtigt des Weiteren, noch 2020 eine gezielte Strategie für einen wirksameren Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern anzunehmen, welche Maßnahmen zur Unterstützung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen umfassen wird.
- Weiterhin soll die Spotlight-Initiative der Europäischen Union und der Vereinten Nationen zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt an Frauen und Mädchen, sowie das weltweite Bündnis zur Beendigung der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet „WeProtect“ unterstützt werden.
- Daneben soll die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und der Industrie ausgebaut und vertieft werden, um Darstellungen von sexuellen Missbrauch von Kindern im Netz schneller aufzudecken und zu entfernen.
- Für ältere Menschen ist es von entscheidender Bedeutung, speziell auf sie zugeschnittene Meldeverfahren für Straftaten einzurichten, um ihnen geeignete Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen
- Weil älteren Menschen häufig die erforderlichen digitalen Kompetenzen fehlen und sie mangelnde Kenntnis über die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel haben, soll für sie die notwendige Hilfe bei der Erstattung einer Anzeige zur Cyberkriminalität sichergestellt werden.
- Bei Opfern mit Behinderungen ist insbesondere zu beachten, dass die zuständigen Fachleute mit ihnen auf eine Weise kommunizieren, die die geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen berücksichtigt.
- Die Barrierefreiheit soll gewährleistet werden, damit Opfer mit Behinderungen Straftaten anzeigen und an Strafverfahren teilnehmen können.
- Maßnahmen der EU-Strategie, die die körperliche, kognitive und psychische Genesung, die Rehabilitation und soziale Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen umfassen, sollen den Standards des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
- Opfern von häuslicher Gewalt sollen jederzeit Zugang zu Schutzmaßnahmen geboten werden, dazu zählen insbesondere Unterkünfte, telefonische Beratungsdienste und psychologische Hilfe. Um die Belastbarkeit der Strukturen zur Unterstützung von Opfern auch in Krisensituationen sicher zu stellen, sollen diese auch in die Pandemie-Notfallpläne integriert
- Ein wirksamer Zugang zu vertraulichen, kostenfreien und den individuellen Bedürfnissen der Opfer entsprechenden Online- und Offline-Opferunterstützungsdiensten, wie psychologische, emotionale sowie auf medizinische Leistungen verweisende Hilfe und andere soziale Dienstleistungen sollen gewährleistet werden, insbesondere zu Zeiten der COVID-19-Pandemie.
- Die nationalen Strafverfolgungsbehörden sollen außerdem alle bekannten und neuen Fälle häuslicher Gewalt besonders aufmerksam überwachen. Dabei soll der physische Schutz der Opfer – insbesondere derer, die in einen anderen Mitgliedstaat reisen oder sich dort niederlassen – absolute Priorität haben.
- Insbesondere die Zivilgesellschaft soll in der Unterstützung und den Schutz der Opfer von häuslicher Gewalt einbezogen werden.
- Risiken der sekundären Viktimisierung, der wiederholten Viktimisierung, der Einschüchterung und der Vergeltung sollen mit besonderer Aufmerksamkeit und Schutz entgegengewirkt werden. Dazu wird die Kommission unter anderem ein EU-Netz zur Verhütung von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt
- Die Kommission setzt sich im Rahmen der Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025 für die Beendigung der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen und Mädchen Dazu gehören Maßnahmen wie der Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul sowie alternative Legislativmaßnahmen, die das gleiche Ziel verfolgen.
- Mitgliedstaaten werden ermutigt, Familienhäuser einzurichten, die gezielte und ganzheitliche Unterstützung für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt bieten.
- Die Kommission beabsichtigt, 2020 eine gezielte Strategie für einen wirksameren Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern anzunehmen, welche Maßnahmen zur Unterstützung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen umfassen wird.
- Unterstützt werden sollen außerdem weiterhin internationale Fonds für Überlebende von konfliktbedingter sexueller Gewalt.
- Die Anzeige von Cyberkriminalität soll erleichtert werden, um Opfer zu ermutigen, Straftaten anzuzeigen und somit die erforderliche Unterstützung zu erhalten. Unter anderem soll erlittener Schaden wiedergutgemacht werden.
- Die Kommission wird Maßnahmen zum Schutz der Opfer von geschlechtsspezifischer Cyberkriminalität ergreifen, insbesondere durch die Förderung der Ausarbeitung eines Rahmens für die Zusammenarbeit zwischen Internetplattformen und anderen Interessengruppen.
- Opfern von Terrorismus sollen in den einzelnen Mitgliedstaaten die notwendige Unterstützung, der Schutz und die Anerkennung Insbesondere bei grenzüberschreitenden Straftaten, sollen sie bei der Geltendmachung ihrer Rechte unterstützt werden.
- Das im Januar 2020 für zwei Jahre gestartete Pilotprojekt „EU-Kompetenzzentrum für Terroropfer“ der Kommission wird Beratungs- und Schulungsaktivitäten zu den Rechten und Bedürfnissen der Opfer von Terrorismus anbieten, die sich auf die bewährten Verfahren der betroffenen Mitgliedstaaten stützen. Bei reibungslosen Ablauf wird die Kommission Ende 2021 die Notwendigkeit einer Fortführung prüfen.
- Zur Unterstützung von Terroropfern wird die Kommission weiterhin Initiativen und Projekte der Vereinten Nationen unterstützen. Beispiele dazu sind die von Afghanistan und Spanien geleitete „Group of Friends of Victims of Terrorism“ oder der weltweite Kongress der Opfer von Terrorismus.
- Intensivere Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und den betroffenen Gemeinschaften ist gleichermaßen bedeutsam wie die spezifische Schulung über Diskriminierung für die Polizei und andere Kontaktpersonen, um das Vertrauen in die Behörden zu steigern und die Opfer von Hassdelikten zur Anzeige von Straftaten zu ermutigen.
- Initiativen der Kommission gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zielen insbesondere darauf ab, die Anzeige von Hassdelikten zu fördern sowie die genaue Untersuchung von Vorurteilen als Motiv für Straftaten und die Unterstützung für Opfer von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu verbessern. Des Weiteren sollen Leitprinzipien über die Gewährleistung des Zugangs der Opfer von Hassdelikten und Hetze zu Recht und Gerechtigkeit, Schutz und Unterstützung umgesetzt werden.
- Die Kommission wird die Mitgliedstaaten weiterhin bei der Entwicklung nationaler Strategien zur Bekämpfung von Antisemitismus unterstützen, um antisemitische Hassdelikte möglichst zu unterbinden und etwaige Opfer zu stärken und zu schützen.
- Eine Initiative mit Maßnahmen zur Gleichstellung und Inklusion der Roma sowie der geplanten LGBTI+ Gleichstellungsstrategie wird von der Kommission erarbeitet.
- Die Hochrangige EU-Gruppe zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz hat beschlossen, zur Unterstützung der nationalen Behörden zwei zusätzlich Arbeitsgruppen einzurichten: zum einen die Arbeitsgruppe zum Thema Schulung von Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf Opfer von Hassdelikten und zum anderen die Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Opfer von Hassdelikten, die eng mit der Kommission zusammenarbeiten sollen. Dabei soll den ethnischen Gruppen und Minderheiten besondere Aufmerksamkeit zukommen.
- Zum Schutz und zur Unterstützung von Opfern in Hafteinrichtungen will die Kommission verschiedene Mittel und Maßnahmen prüfen. Hierzu gehören unter anderem unabhängige Stellen für Hafteinrichtungen, die Straftaten in Haft untersuchen.
- Im Rahmen der Strategie der europäischen justiziellen Aus- und Fortbildung soll außerdem die entsprechende Schulung des Strafvollzugspersonals gefördert werden.
- Um insbesondere der häufigsten Opfergruppe von organisierter Kriminalität besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, soll den Opfern von Menschenhandel Hilfe, Unterstützung und Schutz gewährleistet werden. Dazu erarbeitet die Kommission einen neuen strategischen Ansatz zur Beseitigung des Menschenhandels im Rahmen der Sicherheitsunion.
- Maßnahmen der EU-Strategie, die die Beseitigung des Menschenhandels umfassen, sollen in der bevorstehenden Initiative zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität weiterentwickelt werden.
- Auch bei Opfern von Umweltkriminalität sollen Risiken zur sekundären Viktimisierung, Einschüchterung und Vergeltung vermieden werden, indem der Zugang zu spezialisierten Unterstützungsdiensten und Schutz gewährleistet wird.
- https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/victimscrimes_factsheet_de.pdf
- https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf
- Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/330/JI
- Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung
- Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates
- Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates
- Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates
- Richtlinie 2004/80/EG des Rates vom 29. April 2004 zur Entschädigung der Opfer von Straftaten
Kontakt
Wolf Krämer
Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa
Landesvertretung Brüssel
T +32 2 282 00 77
wolf.kraemer@europa.bremen.de